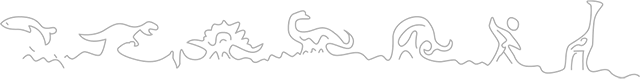Tierische Spiele entziehen sich weiterhin einer evolutionären Erklärung.
Gemäß Charles Darwins Evolutionstheorie wird das Verhalten eines Organismus angeblich durch das Bedürfnis nach biologischem Überleben motiviert. Wie kann sie dann Merkmale erklären, die nichts mit dem Überleben zu tun haben, wie zum Beispiel das Spielverhalten von Tieren? Die einfache Antwort lautet: Die Evolution kann es nicht.
In einem Artikel in der Quarterly Review of Biology schrieben die Forscher Kerry Graham und Gordon Burghardt:
„Spielverhalten ist ein Paradoxon bei Menschen und Tieren, das zwar allgegenwärtig, aber nicht eindeutig ist.“
In einem Überblick über die aktuelle Forschung zu diesem Thema wurde die Ambivalenz der evolutionären Ursprünge des Spielens nur noch unterstrichen. Die Autoren der Studie präsentierten eine Mischung aus interessanten Beobachtungen aus aktuellen Forschungen zum Spielverhalten von Tieren sowie verwirrenden, unwissenschaftlichen „Erklärungen“ im evolutionären Kontext.
Sie zeigten beispielsweise, dass Studien bei den meisten Versuchstieren, sogar bei einigen Insekten, spielerisches Verhalten nachweislich festgestellt haben, gemäß einigen biologischen Definitionen des Begriffs „Spiel“. Das Spielverhalten von Tieren ist kein einzelnes Merkmal, sondern ein Verhalten, das mit einer Vielzahl von Merkmalen verbunden ist, wie bestimmten neuronalen Verbindungen und instinktiven Verhaltensdaten über Gewohnheiten. Darüber hinaus erscheint Spiel als nicht ernsthaft. Wie erklärt die darwinistische Interpretationsstruktur plausibel die Entstehung mehrerer miteinander verbundener Merkmale, die dazu dienen, ein Verhalten zu erreichen, das keinen eindeutigen Einfluss auf das Überleben hat?
Wären die Vorteile von Spielen für das Überleben von Tieren offensichtlich, würden Evolutionisten diesen Faktor mit der evolutionären Vergangenheit in Verbindung bringen, ohne überhaupt eine vererbte Grundlage für ein so komplexes Verhalten festzustellen.
Die Studie konnte die Unklarheit der evolutionären Erklärungen für das Spielverhalten nicht beseitigen. Nach der Erwähnung, dass einige Tiere leise und andere laut spielen, sowie unter Verweis auf bestimmte Gehirnaktivitäten, die mit diesem Verhalten einhergehen, schreiben die Autoren:
„Äquivalente des Lachens bei verschiedenen Arten weisen auf den Ursprung des Spielens und seine evolutionäre Bedeutung hin.“
Die Forscher liefern jedoch keine Argumente zur Untermauerung dieser Behauptung. Was macht die Lautäußerungen eines Tieres zu einem Äquivalent des menschlichen Lachens? Und welchen Überlebensvorteil bietet ein solches Verhalten? Wenn spielerische Lautäußerungen einen Vorteil bieten, warum haben dann nicht alle Tiere die Fähigkeit entwickelt, während des Spiels Laute von sich zu geben? Diese Fragen bleiben unbeantwortet und unterstreichen die Unfruchtbarkeit leerer Rhetorik über die angebliche „evolutionäre Bedeutung“.
In Anlehnung an den alten „Glauben, dass Spielen für die Entwicklung junger Tiere wichtig ist” führten die Autoren einige Experimente durch, in denen es keinen Unterschied in der Entwicklung zwischen jungen Tieren, die nicht spielten, und denen, die spielten, gab. Beobachtungen verschiedener Arten zeigten, dass soziale Interaktionen zwischen Erwachsenen die Aktivität der Jungtiere beeinflussten, aber keine davon verband spielerisches Verhalten mit einer erhöhten Überlebensfähigkeit.
In einem Abschnitt der Übersicht, in dem die möglichen entwicklungsfördernden Effekte von Spielen in der evolutionären Entwicklung diskutiert wurden, wurden ein halbes Dutzend Spekulationen angeführt, die jeweils mit dem Wort „könnte” in dem Sinne formuliert waren, dass „das Spiel von Tieren eine Reihe allgemeiner Verhaltensweisen darstellen könnte, die mit der Evolution der Gesellschaft zusammenhängen”. Jede Aussage vom Typ „könnte” impliziert jedoch zwangsläufig ein potenzielles „könnte nicht”, was den Leser daran zweifeln lässt, ob die im Titel der Studie erwähnten „Anzeichen für Fortschritt” tatsächlich zutreffen.
Selbst nach der Wiederaufnahme der Forschungsbemühungen leugnen Tier-Spiele weiterhin ihre evolutionären Ursprünge. Allerdings haben Tier- und Menschenspiele im Kontext der Schöpfung einen Sinn, in dem ein mächtiger und gütiger Gott jedem seiner Geschöpfe sowohl ästhetische als auch lebenswichtige Eigenschaften verliehen hat.